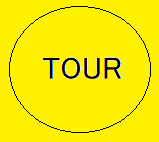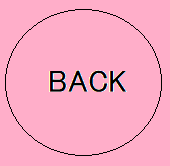Weil er schon Mitte vierzig war, konnte er auch leider keine neue Arbeit kriegen. Obwohl die Familie sehr wenig Geld hatte, ging es ihnen besser als den meisten anderen, auch wenn sie eine Zeit lang von der Fürsorge leben mussten, die heute Sozialhilfe heißt. Sie bekamen nämlich von den Eltern meines Urgroßvaters Obst und Gemüse aus dem Garten und die Urgroßmutter konnte gut nähen, und machte oft aus alten Sachen noch neue Kleidung für die Kinder.

Aber auch wenn sie nicht viel Geld hatten, sieht es doch aus, als ob Opa Diegos Familie trotzdem eine Menge Spaß gehabt hätte.

Opa Diego kam 1933 in die achtjährige Volksschule, die er bis zum Ende besuchte. Die ganze Zeit wohnte er mit seiner Familie im selben Haus in Bramfeld.
Opa Diego kam erst mit sieben Jahren zur Schule, seine Mutter sagte ihm, weil er immer krank war. Er selber glaubt aber, dass sie ihn noch zu klein fand, denn er kann sich an keine Krankheit erinnern. Mein Großvater hatte immer einen schönen Schulweg, weil in ganz Bramfeld damals erst drei Autos fuhren. Ansonsten gab es noch viele Pferdefuhrwerke. Erst wartete mein Opa auf seinen beste Freund Kurt Ruff, und dann kamen an jeder Straßenecke immer mehr Kinder aus seiner Klasse dazu. Dann gingen sie zusammen „spielend“ zur Schule, vorbei an vielen Kühen und Kornfeldern. Als Bramfeld noch nicht zu Hamburg gehörte, mussten sie in der Schule noch die „Deutsche Schrift“ lernen und dann erst 1936 die lateinischen Buchstaben.
Mit seinem Bruder Wolfgang hat mein Opa öfter Streiche gemacht, aber erwischt wurden meistens nur er und seine gleichaltrigen Freunde, weil die Großen besser weglaufen konnten. Wenn sein großer Bruder manchmal keine Lust hatte mit ihm zu spielen, hat er meinen Opa einfach über den Zaun aufs Nachbargrundstück gesetzt und ist dann weggelaufen. Bis der Kleine es geschafft hatte, wieder von dem fremden Grundstück zu kommen, waren die Großen längst über alle Berge.
Mein Opa und seine Freunde bauten aus alten Kinderwagen Fahrzeuge zusammen und einmal haben sie sogar ganz alleine ein richtiges Boot gebaut und es hinterher mit Farbresten schön angemalt. Dann haben sie es auf einem ihrer selbstgebauten Fahrzeuge zum Bramfelder See gebracht und zu Wasser gelassen. Er schreibt: „Es versank mit der ganzen Besatzung im See. Es wurden alle gerettet, nur das Boot nicht. Der See war an dieser Stelle nur ca. 1 Meter tief.“ Bei schlechtem Wetter hat mein Opi viel gelesen und gezeichnet, genau wie ich und er hat als Kind auch oft noch abends mit der Taschenlampe unter der Bettdecke gelesen, auch genau wie ich. Wir haben noch etwas gemeinsam. Mein Opi hat als Kind gern Streiche gespielt. So hat er zum Beispiel in einem ausgetrockneten Graben, der mit Gras zugewachsen war und eine gute Deckung war, gehockt und eine Geldbörse an einem Band auf den Gehweg nebenan geworfen und sie weggezogen, wenn sich jemand der vorbeikam, danach bückte. Auf dem Dachboden in seinem Elternhaus haben die Brüder einmal sogar einen alten Helm und einen echten Säbel gefunden. Damit haben sie dann Seeräuber und Entdecker gespielt. Als ihre Eltern dann wieder beide Arbeit hatten, haben sie tagsüber von selbstgeschmierten Broten gelebt und konnten fast immer machen, was sie wollten. Einmal haben sie sogar einen kleinen Bach, der vom Bramfelder See durch die Wiesen floss, mit Gras und Steinen aufgestaut, bis er über die Ufer trat und die ganze Gegend überschwemmte. Mein Opi schreibt über seine Eltern: „Sie hätten sich mehr um uns kümmern sollen, von wegen Schulbildung und so. Aber sie hatten eine Menge eigener Probleme, auch um uns satt zu kriegen. Für uns Kinder war die Freiheit natürlich wunderbar. Meine Eltern waren überhaupt nicht streng und es fehlte auch nicht an Liebe und Streicheleinheiten. Geschimpft wurde nur ganz selten und gehauen überhaupt nicht. Wenn Vater mal schimpfen sollte haben wir ihn meistens irgendwie zum Lachen gebracht und dann war schon alles wieder gut. Wir haben auch immer Besserung versprochen. Es klappte aber meistens nicht.“
Als Opa Diego 1941 aus der Schule kam, hatte der Krieg schon angefangen und manchmal gab es schon Schäden und Fliegeralarm.
Mein Opa und sein Bruder wussten nicht so recht, was sie machen sollten. Mein Großonkel probierte verschiedene Berufe aus und arbeitete dann in der Landwirtschaft. Mein Opa wollte gerne Koch oder Konditor werden aber das war seinen Eltern nicht recht. Darum fing er im April 1940 eine Lehre als Kaufmann in einer Lebensmittelfirma im Burggarten an, das ist ganz in der Nähe unserer Wohnung in der wir heute laben. Dazu schreibt er: „Meine Arbeit in der Firma bestand hauptsächlich aus praktischer Beschäftigung auf dem Lager oder als Beifahrer, wenn irgendwelche Engpässe zu überbrücken waren. Meine Warenkunde-Kenntnisse wurden dabei erweitert und ich konnte schon bald Makkaroni und Spaghetti unterscheiden. Auch der Umgang mit einer Dezimalwaage war bald kein Problem mehr. Im Büro musste ich zuerst nur selten helfen und wenn, dann nur in der Registratur wo es um das Ablegen der Unterlagen in verschiedene Ordner ging, sehr langweilig. Auch wurden uns Lehrlingen Botengänge abverlangt und dann waren wir oft stundenlang in der Stadt unterwegs, manchmal auch schnell in einem Kino.“ Die Firma, in der mein Opa lernte, hatte drei Lehrlinge und obwohl er erst im 1. Lehrjahr war, war er genauso alt, wie der Lehrling im 2. Und der im 3. Lehrjahr. Alle drei waren 1925 geboren, aber der erste war mit fünf, der zweite mit sechs und mein Opa erst mit sieben Jahren zur Schule gekommen. Weil es immer mehr Luftangriffe gab, musste immer einer der Angestellten in der Firma als Brandwache übernachten um zu löschen, falls eine Brandbombe fiel. Im Januar 1941 wurde mein Opa zum Arbeitsdienst nach Ostpreußen eingezogen. Da war er gerade sechzehn Jahre alt.
Davor war Opa Diego mit zehn Jahren zu den Pimpfen gekommen und mit vierzehn Jahren in die Hitlerjugend. Dort mussten sie einmal in der Woche hin und bekamen dort politischen Unterricht und sangen Nazilieder, Sie machten auch Geländespiele, wo sie schon üben sollten, was Soldaten machen.
Beim Arbeitsdienst kam er in die Schreibstube, weil er Schreibmaschine konnte. Aber er musste auch Gräben ausheben und mit Gewehr schießen [unleserlich]. Außerdem mussten sie oft Liegestütz im Schnee ohne Handschuhe machen. Nach sechs Wochen wurden sie mit dem Zug nach Frankreich geschickt, wo sie mit einem Gewehr und scharfer Munition herumlaufen mussten. Sie bekamen französisches Geld ausgezahlt und kauften sich davon etwas zu Essen, weil sie nicht genug bekamen. Sie hatten überhaupt keine Freizeit und mussten immer exerzieren. Sie wurden sogar nachts aus den Betten gescheucht, um irgendwo Zigarettenstummel einzusammeln, wenn jemand welche liegengelassen hatte. Bevor sie als richtige Soldaten eingezogen werden sollten, bekamen sie noch ein paar Tage Urlaub. Aber es war gerade Juli 1943 und es waren die schlimmsten Luftangriffe auf Hamburg. Als er am 27.7.43 am Hannoverschen Bahnhof sein sollte, brannte alles und es fuhren keine Züge, so dass er nur bis zum Berliner Tor kam. Weil er nicht aus dem brennenden Hamburg herauskam, meldete er sich mit seinem Einberufungsbefehl bei der Polizei und konnte erst einmal bis Ende September bei seinen Eltern in Bramfeld bleiben, aber dann kam er zu einer Grundausbildung nach Dänemark. Dort wurden die Jugendlichen so schlimm behandelt wie in einem Strafgefangenenlager. Weil sie dort immer gequält wurden, meldeten sie sich alle geschlossen freiwillig zur Ostfront. Sie dachten, dass es dort auch nicht schlimmer sein könnte und wollten wohl auch ihren Ausbildern eins auswischen. Sie mussten dann fünfundvierzig Tage in Viehwagons der Eisenbahn bis Bobruisk fahren.

Dort kamen sie in eine ehemalige russische Kaserne wo alles voller Wanzen war und sie mussten am Flussufer Verteidigungsgräben ausheben am Ufer des Dnjepr und die dann nachts bewachen. Sie hörten wie der Geschützdonner immer näher kam und mussten Bahnlinien bewachen, die oft von Partisanen angegriffen wurden. Dabei sind viele, die er kannte, umgekommen. Es wurde immer schlimmer und weil mein Opa dort wieder weg wollte, bewarb er sich als Funker und schaffte es auch. Aber jetzt musste er mit seinem Funkgerät immer auf den Lastwagen mit der ganzen Munition fahren, da hatte er noch mehr Angst. Er musste später, wenn sie sich zurückzogen, immer bis ganz zum Schluss dableiben und Funkverbindung halten oder mit dem Funkgerät auf dem Rücken zwischen verschiedenen Frontabschnitten hin und herlaufen.