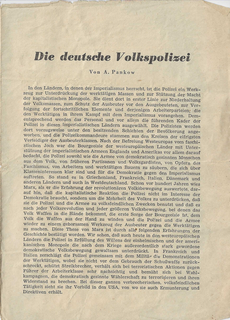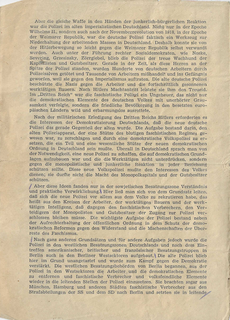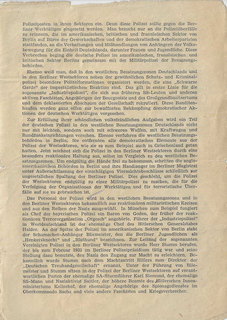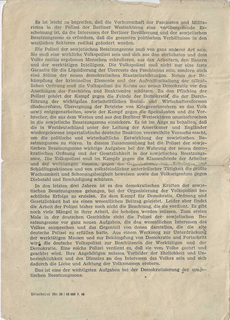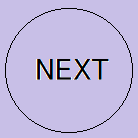Lebenslauf Hilku
Am 4. Februar l928 wurde ich als Kind des Bauarbeiters Rudolf Delakowitz und seiner Ehefrau Viktoria in Potsdam geboren. Meine Eltern wohnten in einer kleinen "Wohnung", bestehend aus einer Küche, die direkt vom Hof aus zu erreichen war, dahinter befand sich die Stube. Wasser gab es auf dem Hof, das Plumpsklo befand sich am Stallgebäude. Sie fanden dann aber bald eine bessere Wohnung. Eine Dachwohnung mit einem großen Zimmer, einer Küche und einer Kammer. Die sanitären Anlagen befanden sich ebenfalls draußen neben der Haustür, Plumpsklo wie gehabt. Das war damals auf dem Lande so üblich.
In der Familie des Hausbesitzers lebten auch seine Kinder. Darunter ein kleines Mädchen - Helga Fenner - in meinem Alter. Da hatte ich eine Spielkameradin. Sie wurde später meine beste Freundin. De Freundschaft besteht heute noch. Als ich 5 Jahre alt war, zogen meine Eltern wieder um. Und zwar in die Bahnhofstraße am anderen Ende des Dorfes in Bornim. Dort hatten wir eine Wohnung in einem Zweifamilienhaus (gemeinsamer Hausflur, dann Küche, Wohnzimmer, Schlafzimmer und Kammer). Wasser und Klo wieder draußen. Auf dem Grundstück des Besitzers stand auch die von ihm bewohnte Villa in einem wunderschönen Garten. Nun hatte ich wieder Spielkameraden, nämlich die 3 Buben des Besitzers. Einer war älter, der andere jünger als ich. Mit dem mittleren ging ich dann zusammen in die Schule. Wir hatten ein ganzes Stück zu laufen. Auf halber Strecke wohnte der Bäcker. Dessen Tochter wartete dann schon immer auf uns. Am 17. Februar 1933 bekam ich ein Brüderchen, Rudi.
Da der größte Wunsch meiner Eltern ein eigenes Haus war, ging auch meine Mutter wieder arbeiten. Wir Kinder wurden morgens ins Kinderheim gebracht und abends wieder abgeholt. Dort hat es uns immer gut gefallen. Da Mutti sehr sparsam war und mein Vater viele Arbeiten am Bau selbst ausführen konnte und auch Kollegen in ihrer Freizeit halfen, nahm Muttis Wunsch feste Formen an. Papas Chef ließ ihm Steine und Mörtel usw. zum Einkaufspreis. So konnte mit dem Bau des Hauses im April begonnen werden. Am 1. Oktober 1938 konnten wir schon einziehen. Wir waren alle selig. Ein Haus für uns allein, mit Keller, Wohnzimmer, Schlafzimmer, Küche, Badezimmer, ein Zimmer für mich, ein Zimmer für meinen Bruder, mit Wasser in der Küche und Toilette im Bad. Es war das erste Haus in der Straße mit Innentoilette. Wenn man baden wollte, musste zwar erst der Badeofen befeuert werden, aber es war doch damals ein Wunder. Unser Grundstück befand sich in der Hugstraße, ganz in der Nähe unserer ersten Wohnungen, so dass ich jetzt wieder mit Helga zusammen in die Schule gehen konnte, die auch nicht weit entfernt war. Es begann eine sehr schöne Zeit.
Doch es blieb leider nicht dabei. Denn am 1. September 1939 brach der 2. Weltkrieg aus. Ich war damals 11 ½ Jahre alt. Nach Abschluss der Volksschule mussten die Jungen zum Arbeitsdienst und die Mädchen, soweit sie nicht auch zum Arbeitsdienst mussten, wurden mit einem Pflichtjahr bedacht.
Danach konnte ich mir dann meinen Wunsch erfüllen, zur Handelsschule zu gehen. Das sollte zwei Jahre dauern, aber die Schule wurde vorzeitig geschlossen und ich kam in einen Rüstungsbetrieb, in dem Feilen chemisch geschärft wurden. Und am 7. Februar l945, 3 Tage nach meinem 17. Geburtstag, wurde ich zur Wehrmacht eingezogen. Dort sollten wir zur Funkerin ausgebildet werden. Aber noch vor Abschluss der Ausbildung war der Krieg zu Ende. Mein Vater war inzwischen auch wieder nach Hause gekommen - er war in Russland. Wir waren alle froh, dass der Krieg vorbei war. Keine Bomben, keine Stalinorgel mehr. Unserem Haus war nicht viel passiert. Aber hinter dem Haus, im Wald, lagen die Toten. Deutsche, Russen, alles durcheinander. Es waren wohl erbitterte Kämpfe.
Ich möchte nie wieder einen Krieg erleben. Halb Potsdam war in einer einzigen Nacht zerbombt worden, es gab also viel zu tun und wenig zu essen. Mir ist bis heute noch ein Wunder, wie das alles geschafft wurde. Es gab doch keine Werkzeuge oder Bagger oder so etwas. Die Trümmerfrauen in Berlin haben die Steine per Hand gesäubert und sortiert. Alle fassten mit an. Ich fand Arbeit in unserem Ort beim Elektroinstallateur im Büro, durfte aber auch kleinere Reparaturen (Bügeleisen u. d.) machen. Dann hat mich ein Freund meines Chefs abgeworben zur Kriminalpolizei. Dort wurde ich als Stenotypistin im K 4 (Abt. Sitte) eingesetzt. Es war sehr interessant dort, ich verdiente nicht schlecht, jeder Tag brachte neue Fälle. Leider konnte man seine Arbeit nicht in Ruhe machen und dann nach Hause gehen. Nein, man sollte geschult werden und unbedingt in die Partei eintreten.
Das wollte ich aber nun durchaus nicht. So kam ich einmal ins Kreuzverhör, dann ein 2. Mal. Eine Kollegin aus dem Personalbüro verriet mir dann, dass ich auch auf der schwarzen Liste stehe. Sie widerrief das dann allerdings. Aber dann wurde ich zum Polizeiarzt geschickt, der mich krankschrieb. Auf meine Frage, was ich denn habe und was ich tun solle, gab er zur Antwort: viel schlafen und viel spazieren gehen wegen Erschöpfung.
Ich sollte wohl nicht mehr mit anderen Kollegen zusammenkommen. Eine Kollegin war schon verschwunden, keiner wusste wohin (sehr viel später erfuhr ich, dass sie in Sibirien war.). Solch ein Schicksal wollte ich nun bestimmt nicht erleiden. Darum sagte ich meinen Eltern, dass ich in den Westen wolle. Sie wollten davon natürlich nichts wissen. Zumal ich ja wirklich nicht wusste, wohin. Aber das war mit egal. Lieber freiwillig in den Westen als gezwungenermaßen nach Sibirien. Damals gab es ja noch keine DDR und keine Bundesrepublik. Damals gab es nur die Ost- und die drei Westzonen. Ich packte also meine Reisetasche, einen Rucksack und mein Akkordeon, das ich unbedingt mitnehmen wollte, weil man das ja nicht schicken konnte. Kleidungsstücke packten wir in Pakete, die sollte Mutti nach und nach schicken, sobald ich eine Adresse hätte. Aber die Pakete durften nicht mehr als 7 Kilo wiegen.
Mein ehemaliger Chef - der Elektromeister - brachte mich zum Bahnhof Friedrichstraße. Von dort fuhr ich nach Marienborn. Zwischen Marienborn und Helmstedt verlief die Grenze. Es gab viele, die "rüber" wollten. Aber ich mit meinem schweren Gepäck? Zu allem Überfluss riss mir auch noch der Koffergriff ab. Nun war guter Rat teuer. Ich war ja nicht die Einzige, die über die Grenze wollte, die meisten wollten abwarten, bis es etwas schummerig wurde und sie den Wald durchwandern konnten. Auf der anderen Seite begann ja schon der amerikanische Sektor. Einige versuchten ihr Glück per Anhalter. Manche hatten auch Glück und wurden von einem der wenigen Autos mitgenommen, wenn sie die richtigen Papiere hatten. Ich stellte mich also auch an die Straße und wartete ab. Endlich kam mal wieder ein Auto, darin saßen ausgerechnet Ostpolizisten. Die hätten mich mitgenommen, aber ich hatte keine Genehmigung. Als sie mein "Gepäck" sahen, konnten sie natürlich verstehen, dass ich das zu Fuß nicht schaffen konnte, nämlich trotz der schweren Sachen den "Spaziergang" durch den Wald. Sie gaben mir aber den freundlichen Rat, in dem einzigen Gasthaus zu warten. In der Nacht würde ein Kollege von ihnen dort nach dem Rechten sehen. An den sollte ich mich wenden, der könnte mir vielleicht weiterhelfen. Ich setzte mich mit vielen anderen auch in die Gaststube und harrte der Dinge, die da kommen sollten. Da kamen zuerst russische Soldaten, die die Ausweispapiere kontrollierten. Einer sah mein Akkordeon und forderte mich mit den Worten "du Musika, du spielen" dazu auf. Ich musste Rosamunde spielen. Wie oft ich das in dieser Nacht spielen musste, weiß ich nicht. Ein Russe wollte das Akkordeon kaufen. Nur mit Mühe konnte ich ihm begreiflich machen, dass das nicht geht.
Als die Russen gegangen waren, bemerkte ich plötzlich einen deutschen Polizisten, der ebenfalls die Ausweise kontrollierte. Als der die Gaststube verließ, folgte ich ihm und sprach ihn an. Ich sagte ihm, dass man mir gesagt hätte, dass er mir weiterhelfen könnte. Er wollte wissen, wer das gesagt hat. Doch die freundlichen Kollegen hatten mir dringend empfohlen, sie nicht zu verraten. Ich sollte einfach sagen, dass ein älterer Mann in einem kleinen Lieferwagen mir den Tipp gegeben hätte. Daraufhin fragte er, was ich denn überhaupt im Westen wolle. Ich sagte ihm, dass eine Freundin Hochzeit hat und mich eingeladen hat. Daher auch das Akkordeon und das viele Gepäck. Aber er wollte nicht. Er meinte, einer will die Freundin besuchen, ein anderer die Großmutter. Wenn ich keine entsprechenden Papiere hätte, geht das nicht. Da gab ich mir einen Ruck und sagte ihm: so, nun will ich Ihnen die Wahrheit sagen. Ich bin bei der Kripo in Potsdam angestellt, fühle mich aber sehr unsicher und wollte daher abhauen. So und nun können Sie mich verhaften. Darauf sah er mich an, nickte mit dem Kopf und meinte "dann müssen Sie rüber". Und zwar zu Fuß durch den Wald. Und mein Gepäck, das konnte ich doch unmöglich schleppen. Da meinte er, ich sollte die wichtigsten Sachen in die Tasche packen und ihm das Akkordeon und den schweren Rucksack ihm überlassen. Er würde ihn gelegentlich mit einem offiziellen Reisenden nachschicken. Ob ich denn im Westen eine Adresse wüsste. Da fiel mit ein, dass ich mich ja mal mit einem unbekannten Soldaten geschrieben hatte, der später in Gefangenschaft geraten war und mir seine Heimatadresse mitteilte. Das war eine Anschrift in Hannover. Die gab ich ihm. Ich war natürlich der Meinung, dass ich meine Sache nie wiedersehen würde und sagte ihm das auch. Aber er winkte ab mit dem Bemerken, dass er ja nicht Akkordeon spielen könne. Und meinen Einwand, man könnte so etwas ja auch verkaufen, die Russen wären ganz wild darauf. Da sah er mich nur an und fragte: sehe ich denn so aus? Ich habe nie wieder etwas von dem netten Polizisten gehört, aber meine Sachen habe ich später vollzählig erhalten. Aber das ist eine andere Geschichte.
Im Dunkel der Nacht gingen wir dann truppweise durch den Wald. Ich kam mit einem jungen Mann ins Gespräch, der schon oft schwarz über die grüne Grenze gegangen war. Wir kamen auch gut durch. Er wusste, wie man das Flüchtlingslager (vor dem mir graute) verhindern konnte, wie man einen "Entlausungsschein" erhielt, ohne sich entlausen zu lassen. Außerdem wusste er, wo man sein Geld umtauschen konnte. Man bekam 7 zu 1, also für 7 Ostmark 1 Westmark. Da schmolz mein Geld ganz schön zusammen. Im Juni 1948 gab es ja die Währungsreform, da gab es dann DM Ost 40,-- in bar. Das restliche Geld musste aufs Sparbuch, wo es dann 10 zu 1 abgewertet wurde. Ich glaube, deshalb hatten auch so viele ältere Leute jetzt vor dem Geldumtausch DM/Euro Angst. Sie wollten nicht noch einmal erleben, dass ihr ganzes Geld nichts mehr wert war. Im Westen gab es mit der Einführung der Deutschen Mark West überall volle Regale in den Geschäften. Im Osten gab es noch immer nichts.
Aber ich war ja nun im Westen. Mein erster Weg führte mich nach Hannover zu den Eltern des unbekannten Soldaten. Er war noch nicht wieder zu Hause und sie behandelten mich nicht gerade freundlich. Ich wollte mich auch nicht aufdrängen, sagte ihnen nur, dass ich ihre Adresse wegen meines Gepäcks angegeben hätte. Per Anhalter fuhren wir westwärts, meist mit LKW, weil das billiger war und sich die Fahrer der leeren Fahrzeuge ein bisschen verdienen wollten. Aber dann hieß es einmal, nun müssten wir runter, denn die Fahrt geht wieder ostwärts. Und da wollte ich ja nun überhaupt nicht wieder hin. Da standen wir nun wieder am Straßenrand und warteten. Da kam ein Bus nach Hamburg. Die meisten zögerten, denn der Spaß sollte DM 9,-- kosten. Aber ich stieg ein. Zwar wollte ich ja eigentlich gar nicht nach Hamburg, sondern weit weg, an den Rhein oder so. Aber dann dachte ich, dass Hamburg vielleicht auch ganz schön ist. Außerdem fiel mir ein, dass meine damalige Chefin immer was von einem Neffen in Hamburg gesprochen hatte, sie hatte mir sogar die Adresse genannt.
Hamburg war dann erst einmal eine große Enttäuschung für mich. Hamburg lag mindestens genauso in Schutt und Asche wie Potsdam und Berlin, alles grau in grau. Mein erster Weg führte mich zur Polizei. Dort konnte man mir aber auch nicht helfen. Ich hatte wenig Geld, schlafen konnte man am Altonaer Bahnhof für DM 2,70 pro Nacht. Morgens musste man aber wieder aus dem Turm raus. Abends konnte man wiederkommen. Man hielt sich so eben über Wasser. Ich hatte ja auch keine Lebensmittelmarken, denn ich war ja noch nicht gemeldet. Also: anstellen bei der Behörde, die die Aufenthaltsgenehmigung vergab. Als ich nach Stunden endlich an der Reihe war, wurde ich gefragt, ob ich Arbeit hätte. Auf mein nein wurde mir bedeutet, dass ich dann auch keine Aufenthaltsgenehmigung bekommen könne. Wieder anstellen in langen Schlangen beim
Arbeitsamt. Erste Frage: haben Sie eine Aufenthaltsgenehmigung nein? Dann können Sie auch keine Arbeit kriegen. Meine Verzweiflung wurde immer größer, mein Geld immer weniger und Hunger hatte ich eigentlich immer. Eine Straßenbahnfahrt kostete damals in Hamburg 20 Pfennige. Die sparte ich und ging zu Fuß durch diese große Stadt. Aber am Altonaer Bahnhof gab es Fischbratwürstchen für 50 Pfennig. Da hatte ich doch wenigstens etwas. Dann suchte ich die Adresse von dem Neffen meiner ehemaligen Chefin raus und wanderte zu Fuß nach Bahrenfeld. Dort suchte ich, nachdem ich die Theodorstraße endlich gefunden hatte, die Nr. 41. Die schien es einfach nicht zu geben. Aber dann stellte ich fest, dass sich hinter dieser Nummer eine Kaserne befand. Das hatte ich ja nicht vermutet. Ich ging dreist und gottesfürchtig hinein und fand den Mann wirklich. Er und seine Kumpels waren von den Engländern gefangen worden und nun als LKW-Fahrer bei den Tommis beschäftigt. Sie wohnten in der Kaserne und wurden auch dort verpflegt. Viele von ihnen waren Sachsen, Brandenburger, Berliner. Ich fühlte mich gleich wie zu Hause. Und hungern brauchte ich auch nicht mehr. Die Verpflegung wer reichlich, da konnte man mir leicht was abgeben. Tagsüber machte ich Hamburg unsicher wegen Arbeitssuche, abends hatte ich essen und zum Schlafen zum Bahnhof Altona. Da kam ich auch mit einer jungen Freu ins Gespräch, die mir vorschlug, es wegen Arbeit doch einmal beim englischen Arbeitsamt zu versuchen. Sie sagte mir auch, wo das ist und wie ich da hinkomme. Es schien alles ganz einfach. Man bot mir eine Stellung als Hilfe in einer Kantine an.
Ich sagte sofort zu. Aber als ich meine Papiere vorzeigen musste, gab man mir diese zurück mit dem Bemerken, dass sie mich nicht einstellen könnten, weil ich in Potsdam geboren hin. Ich könnte ja eine Spionin sein. Aber ich versuchte es wieder. Diesmal war eine Stellung als Kindermädchen bei einer englischen Familie frei. Der Offizier war seinerzeit in deutscher Gefangenschaft, hatte es aber gut getroffen und somit auch gut auf die Deutschen zu sprechen. Aber auch er stolperte über meinen Geburtsort. Sofort wurde er kühler und fragte, wie ich beweisen könne, dass ich keine Spionin sei. Da antwortete ich ihm, dass ich das nicht beweisen kann, das müsste man mir so glauben. Und er glaubte mir.
Seine Sekretärin musste mit mir nach Othmarschen, wo viele englische Familien lebten, fahren, um mich bei Frau Wheeler vorzustellen. Sie war mit mir zufrieden und ich konnte sofort anfangen. Im Portemonnaie hatte ich noch ganze 40 Pfennige, ich hätte nicht gewusst, wo ich die Nacht hätte schlafen sollen. Ich hatte also wieder mal Glück gehabt. Meine Chefin war sehr nett. Ich hatte ein wunderschönes Zimmer und kam mit allen gut zurecht. Ich musste mich um die Kinder kümmern (ein Mädchen von 3 Jahren, eine von 7 und ein Baby von einigen Monaten.) Das Baby versorgte Missis Wheeler selbst, ich musste nur die Babysachen waschen. Das machte direkt großen Spaß, weil ich dafür Seifenflocken bekam. So etwa kannte ich ja überhaupt nicht. Jennifer, die Große, war tagsüber in der Schule und machte nicht viel Arbeit und Jane, die Kleine, war ein niedliches Gör, die mir viel Spaß machte.
Als Gehalt bekam ich DM 50,-- West. Das war viel Geld. Und Verpflegung und Unterkunft kam je noch dazu. Nachdem ich nun einen Monat dort war, sollte ich nun mein Gehalt bekommen. Aber das ging über eine englische Behörde. Und da ich noch immer nicht gemeldet war, bekam ich erst einmal nichts. Ich nahm mir also einen Vormittag frei und ging wieder zur Behörde. Es dauerte und dauerte. Die Schlange auf der Treppe schien kein Ende zu nehmen. Als wir die Tür schon sehen konnte wurde ich ganz aufgeregt. Ich kam mit einem netten älteren Herrn hinter mir ins Gespräch und sagte ihm: wenn ich jetzt wieder rauskomme und heule, dann hat es nicht geklappt. Dann durfte ich auch schon eintreten. Dort waren alle sehr nett und ich hätte meine Aufenthaltsgenehmigung auch kriegen können, aber das kostete DM 3,--. Und ich hatte kein Geld. Als ich wieder draußen war, hatte ich zwar nicht geheult, aber gelacht auch nicht. Ich erzählte das dem netten Herrn. Der gab mir daraufhin DM 3,-- und schubste mich gleich wieder in die Tür. Ich wer selig als ich wieder draußen war. Die 3,-- habe ich ihm später zurückgezahlt. Denn nun bekam ich ja meinen Lohn. Außerdem bekam ich auch Lebensmittelkarten, die ich nun eigentlich gar nicht mehr brauchte. Nur 1 Pfund Zucker wollte die Engländerin von mir haben, mit Zucker war sie immer knapp. Und all die anderen Sachen